Macht euer Testament!
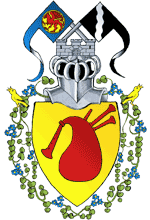
Macht euer Testament!
Vom Erbstreit zweier Taugenichtse
ANGBAR. Wer mit Reichtümern gesegnet und mit einer habgierigen Sippschaft gestraft ist, hat im Leben viel zu leiden — und manch einer sogar darüber hinaus. So erging es dem ehrenwerten Goldschmied und Ratsherrn Aldur Stiepenbrink aus Angbar, der kürzlich im reifen Alter von 57 Jahren die Fahrt übers Nirgendmeer antreten musste.
Der sonst so ordentliche und umsichtige Mann hatte zur Verwunderung aller kein Testament hinterlassen und auch nicht mehr die Gelegenheit gefunden, seinen letzten Willen mündlich zu verkünden, denn mitten in der Arbeit riss ihn der Boronsschlag aus dem Leben. So kam es, dass sein beachtliches Vermögen, wie es Recht ist, unter die noch lebenden Verwandten aufgeteilt wurde. Es fanden sich nur noch zwei Neffen, die mit dem Verstorbenen so viel gemein hatten wie Grillen mit Ameisen. Der eine war nämlich in seiner Jugend, statt ein rechtes Handwerk zu erlernen, auf Abenteuerfahrt gezogen, von der er Jahre später mit vielen Narben, wenig Ruhm und keinem Kreuzer in der Tasche zurückkehrte; der andere hat Angbar nie verlassen, alles nur Erdenkliche versucht und schließlich festgestellt, dass er ein großes Talent zum Fliegenfangen, Zechen und Spielen besitzt.
Diesen beiden fiel nun also das beachtliche Vermögen des verstorbenen Oheims zu gleichen Teilen zu, und es wurde durch die ehrenwerte Amtsfrau Griselde Kannengießer redlich geschätzt und aufgeteilt. Um die beiden kleinen Apfelgärten, die der Onkel auf dem Lande vor der Stadt besessen hatte, kam es bald zum Streit, da jeder der beiden Erben der Meinung war, er selbst hätte den schlechteren, der andere den besseren Teil erhalten. Sie beschuldigten die Amtsfrau — zu Unrecht, wie wir hier betonen wollen! — parteiisch und ungleich entschieden zu haben. Empört übergab diese daraufhin den Fall an Meister Garbolosch, den Sohn des Garbonax, dem es mit zwergischer Beharrlichkeit gelang, die „Apfelgärtenfrage“ zu entscheiden.
Wirklich schwierig aber wurde der Fall erst, als über das Anwesen in der Drachengasse verhandelt wurde, das auch die Werkstatt des verstorbenen Goldschmiedemeisters beherbergte. Schon einen Tag nach dessen Tode hatten die Erben den alten Hausknecht und die tüchtige Gesellin fortgejagt, ohne ein Wort des Dankes, geschweige denn ein kleines Abschiedsgeld, wie es unter anständigen Leuten üblich ist. Das Haus nun forderte jeder der beiden für sich alleine, was freilich nicht möglich war. Weder willigten sie ein, es zu verkaufen und den Erlös zu teilen, noch es zu vermieten und gleiches mit dem Mietzins zu tun. Jeder führte auch Gründe an, warum das Haus ihm allein und nicht dem anderen zustände: „Du hast dem Oheim viele Jahre auf der Tasche gelegen und so gewiss die Hälfte des Hauswertes verprasst“, sagte der Abenteurer. „Und du hast ihm so manchen Taler abgeschwatzt, um dir die Ausrüstung für deine Fahrten kaufen zu können“, erwiderte der andere. Schließlich zählten sie all die Boshaftigkeiten und Garstigkeiten auf, die ihr Kontrahent dem Onkel in Wahrheit oder angeblich jemals zugefügt hatte, um zu beweisen, dass Meister Stiepenbrink — hätte er ein Testament verfasst — nie und nimmer diesen da zum Erben eingesetzt hätte. Am Ende gingen sie sogar so weit, dass sie einander beschuldigten, den Onkel durch Gift oder einen furchtbaren Schreck vom Leben zum Tode befördert zu haben.
Da riss dem Meister Garbolosch der Geduldsfaden, und in größter Empörung rief er aus: „Wenn man euch so sprechen hört, dann wundert man sich, dass der rechtschaffene Mann nicht aus Borons Halle zurückkehrt, um das Versäumte nachzuholen!“ Gerade wollten die beiden Grünschnäbel ihm eine Antwort erteilen, als etwas Unglaubliches, höchst Merkwürdiges, ja Unheimliches geschah: Die Schreibfeder auf Meister Garboloschs Tisch erhob sich wie von Geisterhand, schwebte zum Tintenfass, tauchte hinein und glitt dann über ein leeres Stück Papier, wobei sie folgende Worte hinter sich her zog: „Ich, Aldur Stiepenbrink, Goldschmiedemeister, Ratsherr zu Angbar, verstorben in meinem achtundfünfzigsten Jahr, verfüge hiermit, dass...“
Mit großen Augen und bleich wie die Olporter Kreidefelsen verfolgten die Anwesenden den Vorgang. Die beiden Erben fanden schneller ihre Fassung wieder und wollten — fast gleichzeitig — nach der Feder greifen, um sie aufzuhalten; da aber donnerte Gevatter Garbolosch mit lauter Stimme: „Lasst sie schreiben!“, und so schrieb die Feder, Wort für Wort und Zeile für Zeile, das Testament des verstorbenen Aldur Stiepenbrink, in dem die beiden Taugenichtse enterbt und das Vermögen für wohltätige und gerechte Zwecke bestimmt wurde: Ein Viertel solle der Gilde zufallen, zwei Zehntel der Flammenden und Erz-Kirche; die brave Hausmagd erhielt eine großzügige Abfindung, die Gesellin alles, was zur Werkstatt und dem Betrieb gehörte, zudem wurde dem Gildenrat empfohlen, sie ob ihrer Tüchtigkeit alsbald zur Meisterprüfung zuzulassen. Das stattliche Haus und die Obstgärten sollten der Perainekirche gehören, um mit dem restlichen Vermögen dort ein Spital einzurichten, das die Stadt schon lange benötigte.
Zeter und Mordio schrien die beiden Neffen, beschimpften und verfluchten Meister Garbolosch und nannten das Ereignis einen lächerlichen Mummenschanz, ein falsches Spiel und einen üblen Betrug, mit dem man sie um ihr gutes Recht zu bringen versuche. Sie argwöhnten, Magie sei hier im Spiele — und überhaupt: Selbst wenn der Oheim aus dem Grabe heraus die Schreibfeder ergriffen hätte, so könne dies doch nie und nimmer gültig sein, da ein Testament vor dem Ableben geschrieben werden müsse. Dieser letzte Punkt war freilich sehr bedenkenswert; der Amtmann aber nahm das Testament in Verwahrung, bis der Fall geprüft worden sei. Man zog die Geweihtenschaft des Herrn Praios, der Frau Hesinde und des Herrn Boron hinzu, schließlich auch einen gelehrten Magus, der aber, nachdem schon Tage verstrichen waren, keine Spuren von Magie mehr finden konnte. Die Stadtrichter durchstöberten Folianten und Gesetzeswerke, doch gab es zu einem solchen Fall keine Bestimmungen und Angaben.
So zog sich die Sache in die Länge, bis die ungeduldigen (und bis zum Hals verschuldeten) Erben eine Eingabe beim Fürsten machten — sehr zum Ärger der Richter und Amtsleute, ist Angbar doch Reichsstadt mit eigener Rechtsprechung, in die der Fürst nicht einzugreifen hat. Freilich hat jedermann das Recht, sich an das Fürstliche Gnadengericht zu wenden, doch üblicherweise nicht in einem laufenden Verfahren. Dieser besondere Fall wurde jedoch vor dem Fürstengericht zugelassen, das am ersten Praiostag in jedem Mond auf dem Hofe der Thalessia abgehalten wird, wobei stets eine große Zahl von Schaulustigen zugegen ist. Erstaunt vernahm unser guter Landesvater die wunderlichen Ereignisse und gestand sogleich, dies sei ein merkwürdiger und schwerer Fall. Lange und geduldig hörte er die Ratschläge der Rechtskundigen, Geweihten und sonstigen Berater an, dann fällte er folgende Entscheidung, die wir für alle, die sie nicht vor Ort vernehmen konnten, im Wortlaut wiedergeben möchten:
„Zuerst einmal muss ich den guten Meister Stiepenbrink ein bisschen tadeln, dass er so etwas Wichtiges wie sein Testament vergessen hat. Sein tragischer Tod lehrt uns, dass man solche Dinge besser beizeiten macht — merkt’s euch gut, meine Koscher. Außerdem hätte er zu Lebzeiten schauen sollen, dass seine beiden Neffen ein ordentliches Handwerk lernen und keine Taugenichtse werden, dann wäre das alles nicht so weit gekommen. Loben muss ich ihn aber, dass er im Nachhinein versucht hat, sein Versäumnis nachzuholen, und das ist in diesem Fall ganz und gar erstaunlich, weil er ja nicht mehr unter den Lebenden weilte. Die beiden Neffen aber tadle ich aufs Schärfste, für ihren unkoscheren Lebenswandel und vor allem für die vielen schlimmen und bösen Worte und das freche Verhalten gegenüber den Amtsleuten. Deshalb verfüge ich, dass das Testament gültig ist und sogleich vollstreckt wird, denn sein Inhalt ist so gut und gerecht und göttergefällig, dass ich es nicht verwerfen will. Damit wir so etwas aber nicht noch einmal erleben müssen, verfüge ich, dass künftig nur noch Testamente, die vor dem Tod verfasst werden, Gültigkeit haben. Drittens soll das im Testament genannte Spital nach seinem Stifter benannt werden, damit man den Vorfall nicht vergisst. Es erhält außerdem eine jährliche Zuwendung von zwölf Dukaten aus der fürstlichen Schatzkammer. Und viertens — damit ist es dann aber genug – wünsche ich, dass diese wunderliche Geschichte aufgeschrieben wird, aber nicht in langweiligem Kanzleigarethi für die Akten, sondern schön zu lesen, denn ich halte das für ein lehrreiches und unterhaltsames Beispiel, das man sich abends am Kamin bei einem Krüglein Ferdoker zu Gemüte führen mag.“
Diesem Wunsche Seiner Durchlaucht ist der Kosch-Kurier natürlich gerne nachgekommen. Die Angbarer Bürger aber jubelten über die weise und gerechte Entscheidung des Fürsten, die manche gar rohalisch nannten. Der eine Neffe, Angbart Stiepenbrink, war von all dem so beeindruckt, dass er als Helfer im Spital arbeiten will; der andere jedoch zog wieder auf Abenteuer aus — manche bleiben eben unbelehrbar.
