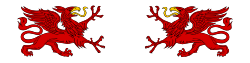Benutzer:Nale/Bastelseite/Bastelprojekt D
Hier entstehen meine Briefspieltexte und werden sorgsam verwahrt, bis ich weiß, wohin sie sollen.
Es ist ausdrücklich erlaubt, Rechtschreibfehler sowie Fehler der Zeichensetzung zu korrigieren, genauso wie verloren gegangene Buchstaben richtig zu ergänzen und überzählige einzusammeln.
Was eine Ritterin werden will
Weitere Texte
[...]
Gründungsmythos Haus Rían
Rían und Támlinn
Rían war ein junger Ritter aus dem Hause Bennain. Er liebte es auf die Jagd zu gehen und trieb sich nur allzu gerne allein in der Wildnis herum. Dort lauschte er dem Rauschen der Blätter im Wind, dem Gesang der Vögel, dem Plätschern der Bäche und all den anderen Geräuschen des Waldes, die sonst keinerlei Beachtung genossen.
Eines Tage, da lauschte er wieder. Die Sonne blinzelte immer wieder zwischen den dicht belaubten Bäumen hindurch, der Waldboden war mit allerlei blühenden Blumen bedeckt. Es roch nach Harz und Moos und Wald. Er stieg von seinem Pferd, um etwas aus dem nächsten Flusslauf zu trinken. Das Wasser war klar und rein. Und während er sich über den kleinen Strom gebeugt hatte, vernahm er ein geradezu liebliches Geräusch. Er lauschte. Es war ein durchdringendes Geräusch. Er lauschte. Ein bekanntes Geräusch, auch wenn er es noch nie gehört hatte. Er lauschte. Und es war ihm tatsächlich, als riefe ihm jemand beim Namen: „Rían. Mein Rían. Wo bist Du? Kannst Du mich hören? Schon so lange suche ich nach Dir! Rían, bist Du da? Rían. Mein Rían.“
Der Ritter stieg auf sein Pferd und ritt dem bezaubernden Klang nach. Er ritt bei Tag und er ritt bei Nacht. Immer weiter und weiter. Bis er schließlich vor einer jungen Frau stand, für deren Schönheit und Anmut er keinerlei Worte finden konnte. Er stand einfach nur vor ihr und schaute sie an und schaute und schaute und schaute.
„Mein Name ist Támlinn“, hob die Fremde mit einer lieblichen Stimme an. In ihrer Hand hielt sie ein silbernes Horn.
„Ich habe von dir gehört! Du bist eine Fee“, erwiderte Rían und Támlinn nickte, „Und das… ist das ein... ein Feenhorn?“
„Es ist ein Feenhorn“, antwortete die Fee, „Und es kommt aus dem Feenreich, sowie auch ich. In vielen Wäldern ließ ich es bereits erklingen, gen Praios und gen Firun, gen Rahja und gen Efferd, doch Du bist der Erste und Einzige, der seinen Klang hörte und ihm folgte.“
Nun schaute Rían ein wenig verdutzt drein. Eine Fee hatte er noch nie gesehen und dann war sie noch so schön, so wunderschön und wie durch einen Zauber, doch ganz ohne jeglichen Einsatz von Magie, verfiel er der Fremden augenblicklich, entbrannte sogleich in heißer und inniger Liebe zu ihr, zu einem Wesen, das so schön war, dass er keine Worte fand um es zu beschreiben und so anmutig, dass er seinen Blick einfach nicht von ihr wenden konnte.
„Ich hab es aus dem Feenreich mitgebracht, von dort komme ich. Dort wurde ich geboren und war Knappin bei der Königin, deren liebste Ritterin ich nun bin. Das Leben dort ist schön und leicht, es gibt keinen Mangel und keine Krankheiten, kein Verderben und keinen Tod. Doch ich sehne mich nach etwas Anderem...“, ihr Blick fiel auf Rían, „... nach etwas, dass ich nur hier in Deiner Welt finden kann. Etwas, dass so allumfassend und so stark ist, dass es mich wieder und wieder in Deine Welt zieht. Ich sehne mich nach der Liebe. Nach Deiner Liebe!“
Rían schluckte angesichts des Geständnisses der Fremden schwer: „Und die Feen, lassen sie Dich denn nicht ziehen?“
„Nicht aus freien Stücken. Wie alle Feen bin ich mit einem Zauber an das Feenreich gebunden, den es erst zu brechen gilt. Bei Tag kann ich zwar durch die Wälder streifen, doch bei Nacht muss ich zurück in meiner Welt sein.“
„Und es gibt keinen Weg, diesen Zauber zu brechen?“
„Doch! Aber nur ein aufrichtiger, tapferer und kluger Recke kann mich befreien. Nur einer, wie Du einer bist, Rían. Du, der Du nicht nur der Einzige bist, der meinen Ruf hörte sondern ihn auch erhörte. Nur Du und nur Du allein kannst mich befreien. Nur Deine Liebe zu mir ist stark genug, um das Band zum Feenreich zu durchtrennen und gleichzeitig ein neues, wesentlich stärkeres zu knüpfen.“
„Ich werde alles tun, alles um Dich aus den Händen der Feen zu befreien, denn Du bist mir das Liebste auf ganz Dere, meine einzig wahre Liebe und mein Leben ist nur vollkommen, wenn Du es mit mir teilst, wenn Du es mit mir auf ewig teilst“, versicherte Rían mit Sehnsucht im Herzen. Und so schworen die beiden sich nicht nur ewige Treue, sondern versprachen sich auch die Ehe.
„In der Nacht zwischen der - wie ihr es nennt - Nacht der Ahnen und dem Tag der Toten musst Du erneut hierher kommen, nur in dieser einen Nacht zur Praiosstunde reitet die Feenkönigin mit ihrem Hofstaat aus. Allen voran reitet die Königin selbst, ihr Pferd mit Glöckchen behängt, dahinter ihre Damen, ihre Knappen und Edelmänner, gefolgt von ihren Rittern und Ritterinnen, unter denen auch ich reite. Unter ihnen allen, wirst Du mich erkennen, an dem schneeweißen Pferd, das ich mein eigen nenne und an dem Handschuh, den ich an meiner Linken trage, nicht jedoch an meiner Rechten. Und dann ist es Zeit, Rían - zieh mich von meinem Pferd und halt mich fest. Ganz fest. So fest Du kannst. Lass mich nicht los. Ganz gleich was geschieht: Lass mich nicht los!“, geradezu flehend sah sie ihn an, „Ihr Schlachtruf wird über Dich hinwegfegen und sie werden mich in etwas abscheuliches verwandeln, wieder und wieder, doch Du musst mich halten, so fest Du kannst, wie auch immer ich aussehe und was auch immer ich sein werde. Sei versichert, was auch immer ich sein werde, niemals werde ich Dir ein Leid zufügen. Niemals. So wirst Du mich für immer aus ihren Händen befreien.“
Erneut versprach Rían all dies zu tun, obgleich er sich fürchtete, denn Feen waren zwar schöne, aber auch unheimliche und nicht zuletzt durchaus gefährliche Wesen und er hatte keinerlei Erfahrung mit ihnen. Er war nicht mehr und nicht weniger als ein einfacher Ritter, der sich nach seiner Liebsten sehnte. Doch sein Herz schlug nur für sie und das machte ihn mutig und stark, denn klug war er immer schon gewesen. So küssten sich die beiden und gingen auseinander.
Und so geschah es: In jener Nacht kam er erneut an diesen Ort, versteckte sich im Schatten des Dornenbaums und wartete. Der Flusslauf glitzerte im sanften Licht des Mondes beängstigend, die Büsche und Sträucher warfen verstörende Schatten auf die Erde und die Bäume raschelten unheimlich mit ihren Ästen. Und als die Praiosstunde kam, da hörte er zuerst die Glöckchen und sah dann ein gleißendes Licht. Zitternd zog er seinen Umhang enger um sich und schaute angestrengt in das Licht. Zuerst kam die Königin, sie war von bezaubernder, aber unnatürlicher Schönheit und ritt auf einem kohlrabenschwarzen Pferd. Ihr folgten ihre Damen, ihre Knappen und Edelmänner, schwatzend und lachend. Den Schluss bildeten ihre Ritter und Ritterinnen, alle gekleidet in das Grün des Waldes und alle mit einem silbernen Horn. Einige ritten auf schwarzen Pferden, einige auf braunen, aber es gab nur ein einziges schneeweißes Pferd, nur eines und die Reiterin trug an ihrer Linken einen genauso schneeweißen Handschuh, nicht jedoch an ihrer Rechten. Sie ritt elegant auf ihrem Ross und drehte dabei niemals ihren Kopf, ihr Blick ging immer gerade nach vorne und selbst aus der Entfernung erkannte er sie, erkannte sie an ihrer Schönheit und an ihrer Anmut. Da sprang Rían aus seinem Versteck heraus, riss die Ritterin an ihrem Umhang von ihrem Pferd und hielt sie fest, ganz fest.
„Támlinn ist fort!“, rief die Königin, deren kohlrabenschwarzes Pferd auf die Hinterhand sprang nur um dann von ihr zum Stehen gebracht zu werden, „Támlinn ist fort!“
Und der Blick der Königin fiel auf Rían, der Támlinn fest umschlungen hielt. Da verwandelte sich seine Liebste plötzlich in einen großen, grauen Wolf, der sich heftig zur Wehr setzte und immer wieder nach ihm zu schnappen versuchte. Doch er ließ sie nicht los. Er hielt sie fest. Ganz fest. Im nächsten Augenblick war sie ein brennendes Strohbündel, dessen Flammen in seinen Ohren knisterten und ihn zu versengen drohten. Doch er ließ sie nicht los. Er hielt sie fest. Ganz fest. Dann hielt er unvermittelt eine riesige Schlange, die sich aufgeregt züngelnd aus seinen Armen zu winden versuchte und die er nur mit größter Mühe darin hindern konnte. Doch er ließ sie nicht los. Er hielt sie fest. Ganz fest. Nun verwandelte die Königin seine Liebste in eine Krähe, die mit ihrem spitzen Schnabel nach ihm zu hacken und mit heftigen Flügelschlägen gegen sein Gesicht das Weite zu suchen versuchte. Doch er ließ sie nicht los, schloss seine Augen und ließ nicht los. Er hielt sie fest. Ganz fest. Da verebbten plötzlich die Flügelschläge. Er schlug seine Augen auf und erkannte in der Krähe seine einzig wahre Liebe, die er noch immer fest in seinen Armen hielt.
Da drehe sich die Königin um, sie hatte verstanden, dass sie verloren hatte. Sie verwandelte Támlinn in ihre eigentliche Gestalt zurück und rief: „Rían, Rían, wenn ich gestern gewusst hätte, was ich heute weiß, dann hätte ich meiner Tochter Támlinn ihre blauen Augen genommen und ihr welche aus Glas gegeben; wenn ich gestern gewusst hätte, was ich heute weiß, dann hätte ich meiner Tochter Támlinn ihr liebendes Herz genommen und ihr eines aus Stein gegeben; wenn ich gestern gewusst hätte, was ich heute weiß, dann hätte ich meine Tochter Támlinn niemals auf diesen Ausritt mitgenommen und sie wäre auf ewig bei mir geblieben, als mein treueste und beste Ritterin und meine Tochter.“
Da tauchte die aufgehende Praiosscheibe den Horizont allmählich in dunkelblaues, weiches Licht und der Hofstaat der Feenkönigin machte sich eilig daran, seinen Ausritt zu beenden und so verklang das Klingen der Glöckchen langsam in der Ferne, bis es schlussendlich erstarb. Da hielt Rían Támlinn noch immer in seinen Armen und er hörte niemals damit auf.
Quellen
Frei nach den Erzählungen
- A Story from an Old Scotch Ballad by Katharine Pyle from Wonder Tales from Many Lands, 1920
- The Tale of Tam Lin, the Elf Knight by Bridget Haggerty
Im Zeichen der Krähe
Im Anflug
1028
Gegen Mittag waren sie von der Otterburg aus aufgebrochen, da war der Himmel schon Wolkenverhangen gewesen. Bald darauf hatte es heftig zu regnen begonnen und Vater und Tochter hatten eilig Schutz unter einem Felsvorsprung gesucht. So standen sie nun da, blickten in den Regen hinaus, lauschten und warteten.
„Mutter wird bestimmt schrecklich weinen... ?“, verunsichert blickte das braunhaarige Mädchen zu ihrem Vater auf. Dieser war etwas überrumpelt, hatte er doch immer geglaubt, Rianod hätte ihre Tränen erfolgreich vor ihren Mädchen versteckt. Dem war aber wohl nicht so...
„Sie hat damals doch bei Ailsa schon geweint! Und als Scanlail dann auf die Bardenschule ging, da hat sie noch viel mehr geweint. Sie hat selbst bei Tara geweint. Mutter wird auch jetzt weinen...“, fuhr sie fort und schaute geradezu nachdenklich in den Regen. Ein paar verirrte Tropfen liefen an ihrer schwarzen Cappa hinab. Die Pferde machten sich über das wenige, aber feuchte saftig grüne Gras her.
„Sie...“, sein Herz war schwer, „...sie liebt euch eben und daher fällt es ihr schwer, von euch Abschied zu nehmen.“
„Ich weiß“, erwiderte sie geradezu stolz, „Ich weiß. Aber Ihr habt mich doch auch sehr lieb und trotzdem weint Ihr nicht, Vater.“
Der Ritter blickte zu seiner Tochter herab und fühlte sich ertappt. Es war nicht das erste mal, dass es ihm so ging. Es schien manchmal gerade so, als könnte sie in einen hineinschauen. Ob seine Tochter ein Talent dafür hatte? Ein besonderes Talent? Ein unheimliches Talent?
„Ich...“, stammelte er nur, „Ich...“
Nun blickte auch er in den Regen und wusste so gar nicht, was er nun eigentlich sagen oder nicht sagen sollte oder vielleicht sogar musste. Wenn nicht jetzt der geeignete, der richtige Zeitpunkt war, wann würde er dann sein?
Der Regen lief ihm durch sein dunkles, kurzes Haar. Er schluckte schwer. Wie sollte er mit seiner Tochter über etwas sprechen, über das er nicht einmal mit seiner Frau hatte sprechen können? Dabei war es sich nicht einmal sicher, ob sie nicht vielleicht etwas ahnte. Ja, vielleicht. Vielleicht hatte es eine stillschweigende Übereinkunft zwischen ihnen beiden gegeben, nicht über etwas zu sprechen, was keiner von ihnen verstand. Schweigen gegen Schweigen.
„Als du geboren wurdest, war es tiefer Winter. Wir waren eingeschneit. Du weißt ja, wie die Winter hier oben auf dem Greifenpass sind. Es war so ein Winter, er war nicht anders als andere auch: Wir waren abgeschnitten und vollkommen auf uns alleine gestellt“, hob er an und dachte etwas wehmütig an jenen Winter zurück. Eine unangenehme Gänsehaut begann seine Arme hinaufzukriechen.
„Es war in solch einem Winter, da wolltest du unbedingt geboren werden, dabei hättest du noch Zeit gehabt. Du warst so klein, Nurinai, so winzig und so schwach, nicht einmal geschrien hast du. Deine Mutter lag drei Nächte und zwei Tage in den Wehen und nichts was die Heilkundige versuchte, konnte ihr Linderung verschaffen und auch ich konnte nur zusehen, hilflos zusehen. Dann in der dritten Nacht – es war ganz still, so still als würde ein jeder den Atem anhalten – da kamst du zur Welt. Niemand sagte etwas, aber wir alle wussten, wie es um dich stand. Alle weinten. Du warst so schwach, dass du nicht einmal trinken konntest. Wir alle waren so erschöpft, wir weinten uns in den Schlaf. Aber ich, Nurinai, ich konnte nicht schlafen. Ich konnte einfach nicht schlafen, obwohl ich so schrecklich müde war. Ich wollte dich nicht verlieren! Natürlich hab ich versucht durch den Schnee zu kommen, aber ich musste einsehen, dass es nur meinen eigenen Tod bedeutet hätte und da war ja noch deine Mutter und deine beiden Schwestern...“
Er schluckte schwer und Tränen glitzerten in seinen Augen. Der Regen war inzwischen schwächer geworden.
„Und dann...“, fuhr er fort und versuchte die Gänsehaut von sich abzuschütteln, wie man Staub aus seinen Kleidern schüttelte, „...es war mitten in der Nacht, da klopfte jemand an die Tür. Ich wachte auf, ich war wohl doch eingenickt. Es war ein lautes, durchdringendes Klopfen und dennoch rührte sich nichts und niemand im Haus. Deine Mutter schlief. Sie hatte sich in den Schlaf geweint. Du lagst noch immer in ihren Armen. Es klopfte wieder und wieder und mit jedem mal unnachgiebiger. Ich ging also und fragte durch die geschlossene Tür: ‚Wer ist da?‘
‚Eine reisende Geweihte, die Obdach für die Nacht sucht‘, wurde mir erwidert.
Ich öffnete und erkannte tatsächlich eine Geweihte und war im ersten Augenblick so entsetzt, dass ich ihr die Tür wieder vor der Nase zuschlug. Ich zitterte am ganzen Körper, mir war schrecklich übel, doch ich besann mich und ließ sie schlussendlich ein.
‚Golgari ist schon unterwegs, Euer Gnaden, da trifft es sich vielleicht ganz gut, wenn er hier auf eine Dienerin des Schweigsamen trifft‘, sagte ich.
Sie schenkte mir ein warmes, jedoch zurückhaltendes Lächeln: ‚Früher oder später ereilt uns alle dasselbe Schicksal.’
‚Einen Grabsegen werdet Ihr ja wohl sprechen können‘, entgegnete ich ihr verbittert.
Wieder lächelte sie: ‚Ihr habt viel geweint, Hoher Herr, und seht erschöpft aus, was immer euch und die Euren auch belastet, ich kann Euch zur Seite stehen, denn wir Diener des Herrn Boron sind für wesentlich mehr da, als dafür Tote zu verscharren, vor allem wenn man nicht irgendeine Geweihte ist, sondern eine Etilianerin.‘
Erst da erkannte ich die zwei silbernen einander zugewandten Raben. Ich war zugegebenermaßen ein wenig verdutzt, hatte zwar schon von den Etilianern gehört, aber noch nie einen gesehen und das obwohl es sehr viele Boron-Geweihte im Kosch gibt. Ich bat sie also nach dir und deiner Mutter zu sehen und was sie fand, war noch schrecklicher als ich erwartet hatte. Als sie die Decke deiner Mutter zurück schlug, lag sie in ihrem eigenen Blut...“, seine Stimme brach, er wischte sich die nahen Tränen aus den Augen, „Sie schenkte mir ein warmes Lächeln und schickte mich warmes Wasser holen. Das tat ich, brauchte aber eine Ewigkeit bis ich die Glut entfacht hatte und noch einmal genauso lange bis das Wasser endlich warm war. Dann badete sie dich und wusch deine Mutter.
Als sie damit fertig war, sagte sie: ‚Ihre Frau und ihre Tochter brauchen nun Ruhe. Lasst sie schlafen, Hoher Herr, und vertraut auf die Götter.‘ Es fiel mir schwer, aber was blieb mir anderes übrig?”
Er zuckte mit den Schultern.
„Sie bat um etwas zu essen, ich gab ihr Wurst, Brot und Käse und saß noch zusammen mit ihr in der Küche. Dort fiel ihr die Wunde an meinem Handrücken auf.“
Er hielt seiner Tochter seinen rechten Handrücken entgegen und mit ihren zarten Fingern fuhr sie über die feine Narbe und wie all die Götterläufe zuvor, durchfuhr sie ein merkwürdiges Kribbeln, wenn sie der feinen Linie in der Haut ihres Vaters folgte. Es war genau genommen mehr als ein Kribbeln, ein merkwürdiger Schauder. Diese Narbe hatte ihr Vater schon, seit sie sich erinnern konnte, schon immer.
„Dann... dann war es also gar kein Hund, der Euch gebissen hat, Vater?“, mit ihren unschuldigen blauen Augen schaute sie ihn an. Ihre Finger ruhten noch immer auf der Narbe.
„Ich muss es wohl selbst gewesen sein“, erwiderte er schulterzuckend und versuchte sich ein Lächeln abzuringen, „Obgleich ich mich nicht daran erinnern kann. Die Wunde war tief. Sie nähte sie. Ich spürte keinen Schmerz. Dann aß sie. Das ist das letzte, an das ich mich erinnere, bevor mich am nächsten Morgen das Geschrei eines Kindes weckte...“
„Das war ich, nicht wahr? Das war ich?“
Der Ritter nickte und Tränen liefen über seine Wangen: „Das warst du, Nurinai. Du schriest aus Leibeskräften und hattest erbärmlichen Hunger. Und auch deiner Mutter ging es besser, noch immer etwas schwach, aber...“
Er hielt einen Augenblick inne.
„Ich vergaß die Geweihte. Die Freude war zu groß. Am Abend jedoch, als ich zur Ruhe kam, da sah ich zum ersten Mal dieses Amulett – diesen schwarzer Karneol – um deinen Hals und ich erinnerte mich. Doch von der Geweihten gab es keine Spur. Es schien mir so, als wäre sie nie da gewesen. Doch jemand hatte etwas von Wurst, Käse und Brot gegessen. Jemand musste die Wunde an meiner Hand versorgt haben und jemand musste euch – deiner Mutter und dir – das Amulett umgelegt haben. Ich ging nach draußen, suchte Spuren. Doch der Schnee lag noch genauso da wie zuvor – strahlend weiß und makellos. Und weil ich keine Erklärung fand, habe ich nie jemand davon erzählt, denn ich war ja der Einzige, der sie gesehen und mit ihr gesprochen hatte.“
Mit großen Augen blickte Nurinai ihren Vater an.
„Manchmal, ja manchmal da bin ich mir einfach nicht sicher, ob... ob es nicht vielleicht doch nur ein Traum... nur Einbildung, nur... nur ein Wahn war. Aber dann, dann muss ich wieder an all die Ungereimtheiten, an all die... Fehler denken. Es kann nicht nur ein Traum gewesen sein, aber was war es dann?“
Er zuckte mit den Schultern.
„Ich habe an den Tempel in Punin geschrieben, der einzige Tempel der Etilianer. Ich wollte wissen, wer die Geweihte war und so schickte ich einen Brief mit ihrer Beschreibung und der Bitte, mir doch ihren Namen mitzuteilen, damit ich mich bei ihr persönlich Bedanken konnte. Ich wollte ihr doch nur meinen Dank aussprechen und davon erzählen, dass es deiner Mutter und dir gut ging. Ich schwöre dir, mehr wollte ich nicht. Doch sie konnten mir nicht sagen, wer es gewesen war. Die Etilianer sind viel unterwegs, fast ausschließlich reisende Geweihte. Aber sie versicherten mir, sich umzuhören. Ich hörte nie einen Namen, sie fanden nie heraus, wer es war. Mir scheint es gar manchmal so, als hätte es diese Geweihte gar nicht gegeben.“, er lachte und schüttelte angesichts seiner gerade getätigten Aussage seinen Kopf, „Seit dem spendete ich jeden Götterlauf eine größere Summe an die Etilianer – immer um deinen Tsatag.“
Da begann seine Tochter herzzerreißend zu weinen. Er schloss sie in die Arme. „Du brauchst nicht zu weinen! Nicht weinen, Nurinai!“, versuchte er sie zu beruhigen, „Nichts davon ist wichtig und für nichts davon kannst du etwas. Das einzig was zählt ist, dass du da bist, dass du lebst!“
Er hauchte ihr einen Kuss auf die Wange: „Vielleicht verstehst du jetzt, warum deine Mutter immer so weinen muss, wenn sie eine ihrer Töchter gehen lassen muss und warum sie es einfach nicht geschafft hat – bei keiner von euch – euch richtig zu verabschieden.“
„Ich hab euch so lieb!“, konnte das Mädchen nur wimmern, „So lieb! Einfach so lieb!“
Da hörte der Regen auf, die Wolken hatten die Praiosscheibe wieder frei gegeben, die nun ihre Tränen trocknete und ihre Herzen mit Zuversicht und Wärme erfüllte. Sie ritten weiter und sangen zusammen. Sie sangen ein altes koscher Wiegenlied.
Sie bogen von der Reichsstraße auf einen schmalen Pfad, dem sie ein ganzes Stück ins Gebirge hinein folgten. Doch irgendwann tauchte der in den bloßen Fels gehauene Tempel vor ihnen auf und Darian wurde mehr und mehr bewusst, dass der Augenblick der Trennung nahe war.
„Vielleicht darfst du das Amulett behalten, wenn du ihnen erzählst, dass du es von einer Geweihten erhalten hast, aber ich kann das natürlich nicht beweisen, ich kenne ja nicht einmal den Namen der Geweihten...“, schlug der Vater vor und hoffte seine Tochter würde ihn bei dieser Lüge nicht ertappen. Tat sie auch nicht. Sie umfasste das Amulett fest mit ihrer Rechten und erklärte mit einer Gewissheit, die ihn erschaudern ließ: „Sie hieß Nurinai, so wie ich.“
Ein Windhauch erfasste das braune Haar des Mädchens. Ein Windhauch, von dem der Vaters nichts spürte. Seltsam ergriffen blickte er zum Tempel.
Landung
[Ankunft im Tempel]
Federn lassen
Wie das Wasser nach einem kurzen Regenschauer in die Erde sickerte, so sickerte die Stille ganz langsam und allmählich in Darian von Trottweiher hinein. Ausgehend von den Zehen begann sie ihn zu durchdringen, füllte ihn immer mehr und mehr aus. Erst macht es ihn ruhig. Ganz ruhig. Sein Atem ging langsamer, seine Gedanken auch. Die Stille hatte etwas Beruhigendes. Er lauschte seinem Herzschlag, seinem eigenen Atem, nahm sich bewusster wahr als je zuvor.
Doch dann stieg die Stille immer weiter, stieg wie der Wasserpegel bei einer Flut, immer höher und höher und riss alles mit sich und die Strömung förderte selbst das zutage, was so lange am Grund getrieben hatte – Unterbewusstes und den unüberwindbaren Drang selbiges endlich auszusprechen.
Und da war er plötzlich, der Praetor. Ganz dicht neben ihm, als habe er gewusst, dass er reden wollte. Ob es so wie bei Nurinai war? Die gewisse Dinge einfach wusste?
„Ich muss mit Euch sprechen, Euer Hochwürden“, hob Darian da leise an, „Es geht um... um meine Tochter. Es gibt da etwas, was Ihr noch nicht wisst, aber... aber was Ihr wissen solltet, weil... weil ihr Leben daran hängt. Das Leben meiner Tochter. Denn sie ist nicht, wie andere. Sie ist... etwas Besonderes.“ In diesem Moment klang er selbst in seinen eigenen Ohren nur wie ein besorgter überfürsorglicher Vater, dem er kein einziges Wort glauben würde.
Er ließ sich jedoch davon nicht beirren und erzählte ihm leise die Geschichte rund um die Geburt Nurinais, so wie er sie zuvor auch seiner Tochter erzählt hatte, doch ihm verschwieg er die Wahrheit nicht: „Sie hat mir ihren Namen genannt, gesagt habe ich das nie jemanden und mit meiner Tochter erst auf dem Weg hierher über ihre Geburt gesprochen. Ich musste mit ihr sprechen, wenn nicht jetzt, wann denn dann? Doch die ganze Wahrheit konnte ich ihr nicht sagen, das brachte ich einfach nicht über mich, weil... weil ich die Ereignisse selbst nicht so recht verstehe, wie sollte ich sie da meiner Tochter erklären?“
Er hielt einen kurzen Moment inne, bis die Stille um ihn herum zu drückend wurde.
„Nurinai, so hieß sie. Zumindest stellte sie sich so vor. Nurinai, wie meine Tochter. Ein seltsamer Zufall, findet Ihr nicht? Oder war es gar kein Zufall? Vielleicht nur Einbildung? Im Nachhinein betrachtet, habe ich mich oft gefragt, was in dieser Nacht Traum und was Wirklichkeit gewesen ist, was Einbildung und was nicht? Aber das jemand in meinem Haus war, das stand außer Frage. Doch wer? Wer war es? Da waren schließlich keine Spuren im Schnee und ich war der Einzige, der sie gesehen oder gar mit ihr gesprochen hatte. Ich verschwieg die Ereignisse der Nacht, was hätte es auch geändert? Wichtig war doch, dass meine Frau und auch meine Tochter am Leben waren. Sie lebten! Gerettet von einer Dienerin des Herren von Tod und Schlaf.“
Darian macht eine Pause und holte Atem. Die ganze Geschichte zu erzählen, ermüdete ihn auf eine merkwürdige Art und Weise oder war es gar Erleichterung? Zum ersten mal seit jener Nacht vertraute er die damaligen Ereignisse jemanden an.
„Mir ließ es trotzdem keine Ruhe. Ich wollte mich bei dieser Geweihten bedanken, ihr davon berichten, wie meine Nurinai wuchs und gedieh. Und so schrieb ich an den Tempel der Etilianer in Punin. Ich schrieb an die Geweihte mit Namen Nurinai, doch...“, seine Stimme brach, „... eine Geweihte mit diesem Namen gab es unter den Etilianern nicht.“
Nun schaute er seinem Gegenüber direkt in die Augen, zog dabei mit zitternden Fingern einen schmalen, abgegriffenen Brief aus seiner Gürteltasche hervor und streckte ihn dem Praetor entgegen.
„Es ist der einzige Beweis, den ich habe“, erwiderte der Ritter, „Abgesehen von meinem Wort.“
Mit zitternden Fingern hielt er noch immer den Brief seinem Gegenüber entgegen.
„Es geht um ihr Amulett, den schwarzen Karneol“, eröffnete er schließlich, „Sie trägt ihn seit jener Nacht, hat ihn nie abgelegt. Sie hat mich nie gefragt, warum sie ihn trägt und seit wann. Ich weiß nicht so recht, warum sie mich nie gefragt hat, aber manchmal scheint sie unterbewusst Dinge zu wissen, die sie nicht wissen kann. Sie spricht ihr Wissen nicht aus, sie handelt einfach. Es ist beängstigend, unheimlich.“
Er schluckte schwer, die Situation war ihm sichtlich unangenehm, schließlich musste er den Praetor bitten für seine Tochter die Regeln zu brechen und konnte dabei nichts weiter ins Feld führen als seine eigene Erinnerung und seine Intuition.
„Ich weiß, dass jegliche Form von persönlichem Besitz verboten ist, Euer Hochwürden, und ich weiß, dass ich gewiss viel von Euch verlange, wenn ich Euch darum bitte, für meine Tochter eine Ausnahme zu machen, ich tu es trotzdem: Bitte lasst ihr das Amulett. Ich will nicht leugnen, dass sie an diesem Schmuckstück hängt, doch noch mehr hängt ihr Leben daran.“
[Antwort des Prätors]
Unter dem Schleier
Verschwiegene Wahrheit (Erster Teil)
Verblassende Erinnerung (Zweiter Teil)
Nirgendmehr (Dritter Teil)
Die Sache mit dem Sterben (Vierter Teil)
Marbolieb (Fünfter Teil)
Verschleiert (Sechster Teil)
Burg Rabenwacht, 27. Ingerimm 1042
„Kein Wort“, würgte Eira ni Rían da hervor, „Kein Wort. Kein einziges Wort glaube ich Dir. Kein einziges!“ Heftig schüttelte sie ihren Kopf, ihre Lider noch immer fest aufeinander gepresst. „Keines.“
Líadáin ni Rían lehnte sich zurück und holte Atem: „Wäre ich an Deiner statt, dann würde ich auch keines meiner Worte glauben. Ich werde Dir Marbolieb vorstellen. Spätestens wenn Du ihr ins Gesicht geblickt hast, dann weißt Du, dass es die Wahrheit ist, dass sie wirklich Sanjas Tochter ist.“
„Ja“, stimmte die Junkerin zu, „Tu das. Es wird doch nur Deine widerwärtige Lüge entlarven.“
„Das werden wir sehen“, schloss die Geweihte.
„Und? War es das jetzt?“, wollte Eira entnervt wissen und blickte ihre Schwester vorwurfsvoll an, „Oder willst Du noch weitere Lügen über sie verbreiten?“
„Es liegt mir fern Lügen über Sanja zu verbreiten. Alles was ich Dir sagte, ist nichts als die Wahrheit. Und ja, das war es jetzt.“
„Dann kannst Du ja gehen“, legte die Junkerin ihr nahe.
„Wenn dies Dein ausdrücklicher Wille ist.“
„Ist es“, bestätigte die Ritterin nickend und wandte ihrer Schwester den Rücken zu, „Geh jetzt.“
Die Geweihte erhob sich schwerfällig. „Zögere nicht, mich aufzusuchen“, verabschiedete sie sich, „Boron mit Dir, blutige Distel.“
Líadáin wandte sich um und hatte ihre Hand schon an der Tür, da wollte ihre Schwester wissen: „Warum... warum trägt sie einen Schleier?“
Die Geweihte wandte sich um und erklärte in ihrer ruhigen Art: „Sanja konnte zwar durch Madas Gabe das Leben ihrer Tochter bewahren, nicht aber ihre schweren Verbrennungen heilen. Zwar ist ihre rechte Gesichts- und Körperhälfte, einem Wunder gleich, genesen, ihre linke jedoch nicht. Dass die Menschen sie immerzu anstarrten, hat ihr schwer zugesetzt. Deswegen habe ich ihr einen Schleier geschenkt und seit dem ist sie sichtlich aufgeblüht, zwar noch immer schüchtern und zurückhaltend, aber sie scheut nicht mehr den Kontakt mit den Menschen. Die schauen zwar immer noch, aber keiner starrt sie mehr an.“
Die Junkerin nickte um zu signalisieren, dass sie die Worte ihrer Schwester vernommen hatte und fragte mit zitternder Stimme: „Und... und Marboliebs Vater?“
„Seinen Namen hat Sanja mit in ihr Grab genommen. Wir werden nie erfahren, wer er war.“
Wie Mutter und Tochter (Siebter Teil)
Tempel unserer gütigen Etilia, TRA/BOR 1043
„Sie hat mich angelogen!“, konnte es Marbolieb Tempeltreu noch immer nicht fassen, „Hochwürden hat mich angelogen! All die Götterlaufe hat sie mich angelogen!“ Vollkommen fassungslos schüttete sie ihren Kopf. „Hat mir meine Mutter vorenthalten. Meine Mutter! Warum?“ Dicke Tränen kullerten dem Mädchen über die Wangen, ihr Schleier war bereits ganz feucht. „Warum?“
Hal von Boltansroden, bei dem sie Trost suchte, wusste gar nicht so recht, was genau geschehen war, doch wie immer blieb er die Ruhe selbst, bat sie zuerst einmal ganz in seine Kammer im Tempel unserer gütigen Etilia, in den sie zum Tag der Toten zurückgekehrt waren, herein und bot ihr in einen Platz in einer kleinen Sitzecke an. „Lass uns zusammen eine Tasse Tee trinken, Räblein“, hob er mit seiner ruhigen Stimme an und goss ihr eine Tasse ein. Heißer Teedampf stieg auf. „Wenn dir kalt ist, wird Tee dich erwärmen, wenn du erhitzt bist, wird er dich abkühlen, wenn du bedrückt bist, wird er dich aufheitern, wenn du erregt bist, wird er dich beruhigen.[1]“ Ihren fragenden Blick konnte er zwar nicht sehen, aber spüren. „Das hat meine werte Frau Mutter – Boron sei ihrer Seele gnädig – stets gesagt“, damit setzte auch er sich, „Du wirst sehen, sie hat recht.“
Schweigend tranken sie ihre erste Tasse Tee. Marboliebs Tränen trockneten allmählich und je leerer ihre Tasse wurde, desto ruhiger wurde sie auch.
„Nun erzähl, Räblein“, forderte er sie ruhig auf als er ihre Tassen ein zweites Mal füllte, „Erzähl.“
„Hochwürden kannte meine Mutter“, hob sie mit brüchiger Stimme an, „Und hat mir doch mein Leben lang vorgemacht, sie nicht gekannt zu haben.“
„Dann bist du...“, wie immer sprach er sehr langsam und bedächtig, „... kein Findelkind?“
Marbolieb schüttelte ihren Kopf und bestätigte: „Kein Findelkind. Meine Mutter hat mich in die Obhut des Tempels – besser gesagt in Hochwürdens Obhut – gegeben.“
„Ich verstehe“, nickte der Geweihte bedächtig, „Und nun grollst du ihr, weil sie es dir verschwiegen hat?“
Zuerst nickte sie nur, dann fügte sie hinzu: „Nicht nur, dass sie es mir verschwiegen hat, Bruder Hal, sie hat mich angelogen! Die ganze Zeit.“ Verständnislos schüttelte sie ihren Kopf. „Angelogen, versteht Ihr?“
Er nickte.
„Ausgerechnet Hochwürden!“, brach es aus ihr heraus, „Ausgerechnet sie! Von uns fordert sie doch stets nichts als die Wahrheit und selbst? Warum hat sie das getan? Warum? Ich kann es einfach nicht begreifen. Dabei war sie... war... war... war wie eine... eine Mutter für mich. Eine Mutter!“
Wieder nickte er: „Vielleicht hat sie es deswegen getan?“
Fragend schaute sie ihn unter ihrem Schleier an. Ihre dunklen Augen glitzerten.
„Mütter schützen ihre Kinder“, erklärte er und trank einen Schluck Tee, „Ganz gleich zu welchem Preis und eine Lüge ist ein äußerst geringer...“
Marbolieb schien verdutzt. Das merkte er ihr auch an. Mittlerweile kannte er sie gut, konnte sie lesen wie ein Buch, auch ohne ihr Gesicht zu sehen. Ihre Körperhaltung verriet ihm viel, obgleich nicht alles. „Wie...“, stammelte sie, „... wie... wie... wie meint Ihr das?“
„Wenn sie für dich wie eine Mutter ist“, griff er ihre Worte auf, „Vielleicht bist du für sie wie eine... hm... Tochter?“
Marbolieb wusste darauf nichts zu erwidern und trank stattdessen einen Schluck Tee.
„Ich denke, dass ich dir nicht sagen muss, dass du weitaus mehr für Hochwürden bist als irgendeine Novizin. Weitaus mehr, Räblein. Weitaus mehr. Und so versucht sie dich ganz besonders zu schützen. Wenn sie dir also die Wahrheit verschwiegen hat, hatte sie gewiss einen guten Grund. Hast du sie dazu befragt?“
Fluch (Achter Teil)
Tempel unserer gütigen Etilia, TRA/BOR 1043
„Ein Fluch“, begann Marbolieb Tempeltreu zu erklären, „Es hatte irgendetwas mit einem Fluch zu tun, dessen Existenz Hochwürden aber bezweifelt, vor dem sich meine Mutter dennoch gefürchtet haben soll.“
„Was für ein Fluch?“, hakte Hal von Boltansroden ruhig nach.
„Das wollte sie mir nicht sagen“, erwiderte die Novizin kopfschüttelnd, „Sie hat aber wiederholt betont, dass es keinen gegeben habe. Trotzdem hatte meine Mutter Angst. Große Angst. Auch um mich. Daher gab sie mich an den Tempel und an Hochwürden.“
Verstehend nickte er.
„Und sie muss wirklich große Angst gehabt haben! Ich meine...“, sie stockte, „Sie hat ihr gerade eben geborenes Kind – mich – an den Tempel gegeben, anstatt mich selbst großzuziehen.“
Wieder nickte der Geweihte.
„Sie muss wirklich sehr verzweifelt gewesen sein...“
„Es ist unsere Pflicht gerade jenen beizustehen“, hob Hal ruhig an, „die sonst nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. Wir sind ihre letzte Zuflucht.“
„Das sagt Hochwürden auch immer“, stimmte die Novizin ihm zu, „Trotzdem... trotzdem hätte sie mir sagen können – nein, müssen – dass sie meine Mutter kannte.“
„Vielleicht“, hob er da nachdenklich an, „Vielleicht wollte sie dich aber auch nur davor schützen, dich zu sehr in den Gedanken an deine Mutter zu verlieren und...“ Der Geweihte hielt einen Moment inne. „... dein Leben damit zu verbringen, auf ihren Spuren zu wandeln und nicht deine eigenen zu hinterlassen.“
Marbolieb schüttelte ihren Kopf: „Auf welchen Spuren denn?“ Die Novizin zuckte mit den Schultern. „Sie ist tot. Im Jahr des Feuers gestorben. Wo sollen denn da noch Spuren sein?“ Geradezu resignierend guckte sie drein. „Ich kenne ja nicht einmal ihr Grab, nur ihren Namen: Sanja von Pul.“
Einen winzigen Augenblick lang glaubte Marbolieb eine Mischung aus Ungläubigkeit und Entsetzen im Gesicht des Geweihten erkannt zu haben, doch es war genauso schnell wieder weg, wie sie es zu sehen geglaubt hatte, wenn es denn überhaupt wirklich da war. Hal von Boltansroden füllte zum dritten Mal ihre Tassen.
„Pul?“, fragte er und räusperte sich, „Sind das nicht... nicht Vasallen der Schneefelser?“
„Doch“, kam die kehlige Antwort der Novizin.
„Dann sollte das Haus Pul deine erste Anlaufstelle sein“, meinte der Geweihte und mühte sich einen Schluck Tee zu trinken. Das Zittern seiner Hände konnte er dabei geschickt verbergen.
„Ja, schon, aber... aber... sehr wahrscheinlich wissen sie nichts von mir und...“, gab die Novizin zu bedenken, „Und ich weiß einfach nicht, was ich ihnen sagen soll...“
„Du bist eine angehende Geweihte des Schweigsamen. Glaubst du wirklich, dass sie dich fragen werden, warum du gekommen bist?“, mit seinen braunen Augen schaute er sie fragend an, „Wohl kaum. Und auch wenn die meisten dort draußen nicht gerne den Tod zu Gast haben, so wird dir keine Tür verschlossen bleiben. Obdach ist dir also mindestens gewiss.“
Mit ihren funkelnden dunklen Augen schaute sie ihn an und wisperte: „Ich war noch nie... noch nie... alleine dort draußen.“
„Dann wird es höchste Zeit, dich dieser Prüfung zu stellen, Räblein“, ermutigte der Geweihte sie, „Du magst den Tag vielleicht hinauszögern, doch kommen wird er. Warum also nicht jetzt?“
„Und...“, suchte die Novizin nach Ausflüchten, „Was soll ich dort draußen tun? Ich habe meine Weihe noch nicht erhalten...“
„Für den Dienst dort draußen an den Menschen ist keineswegs eine Weihe notwendig“, versuchte Hal sie zu beruhigen, „Unser Herr hat dich immer auf deinem Weg begleitet. Das wird auch nun nicht anders sein. Weihe hin oder her.“
„Und...“, hob sie da mit sichtlichem Unwohlsein an, „Und wenn sie mich doch fragen?“
„Dann tu das, was wir, die Diener des Schweigsamen, angeblich am Besten können: Schweige.“
Da blickte Marbolieb ihn mit den Augen ihrer Mutter an und für einen Moment setzte sein Herz aus.
Ohne Vater (Neunter Teil)
Tempel unserer gütigen Etilia, TRA/BOR 1043
„Räblein?“, hob Líadáin ni Rían an, „Sie war bei Euch, Bruder?“
Hal von Boltansroden nickte, setzte sich auf den Gebetsteppich neben ihr und erwiderte: „So ist es, Schwester.“
Da senkte die Geweihte demütig ihr Haupt: „Dann wisst Ihr nun wohl alles...“
Erneut nickte er: „Im Augenblick ist sie noch verwirrt und auch wütend. Für sie ist Dere aus den Fugen geraten. Doch das wird sich geben, auch wenn es Zeit brauchen wird...“
Líadáin seufzte: „Was müsst Ihr jetzt nur von mir denken...“
„Das Ihr gewiss gute Gründe hattet zu tun, was Ihr tatet“, antwortete Hal da schlicht, „Und das Ihr für Räblein stets immer nur das beste gewollt und sie daher besonders beschützt habt.“
„Ich habe es stets versucht und dabei doch versagt.“
„Menschen sind wir und keine Götter und selbst sie, sind nicht vollkommen. Wie könnten wir es da sein?“
„Wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätte sie es nie erfahren“, gestand die Rían, „Sie wäre auf ewig geblieben, was sie war: Ein Findelkind. Keine Mutter, keinen Vater. Es wäre besser für sie gewesen. Doch jetzt...“ Sie zuckte mit den Schultern. „... jetzt wird sie nach ihrer Mutter suchen.“ Líadáin seufzte. „Und all den Dreck aufwühlen, vor dem ich sie stets zu schützen suchte.“
„Sie ist gefestigt und ihr Dienst am Schweigsamen gibt ihr Kraft.“
„Und dennoch ist das, was hätte sein können verführerisch. Vor allem für so einen jungen Geist“, sie schenkte ihm einen besorgten Blick, „Vor allem dann, wenn das, was man aufwühlt nur Dreck und noch mehr Dreck ist.“
„Sie hat Euch!“
Die Geweihte lachte kehlig.
„Sie mag Euch im Moment zürnen, doch früher oder später wird sie in Eure Arme zurückkehren. So lange müsst Ihr ihre Ablehnung ertragen, auch wenn es Euch noch so schwer fällt.“
Nun nickte sie: „Ich hoffe sehr, dass das Wandeln auf den Spuren ihrer Mutter sie nicht zu weit von mir fort treibt.“
Einen Moment schwiegen beide.
„Hochwürden“, hob Hal vorsichtig an, „Ist es wahr, dass Sanja von Pul ihre Mutter ist? Ich meine... war?“
Die Prätorin nickte: „So ist es. Sanja suchte bei mir Rat und Hilfe. Ich fürchte jedoch, dass ich an ihr schuldig geworden und meine mir von unserem Herrn übertragenen Aufgabe nicht gut genug nachgekommen bin. Ich konnte ihr nicht helfen. Zu groß ihre Angst vor diesem ominösen Fluch. Zu groß ihre Angst meine Schwester, die sie von Herzen liebte, zu verlieren. Am Ende konnte ich ihr nur das Sterben erleichtern. Mehr vermochte ich für sie nicht auszurichten. Bis heute erschließt es sich mir nicht, wie sie zu ihrem Kind kam. Gewiss haben sich die Götter etwas dabei gedacht, auch wenn ich wohl nie wissen werden, was es gewesen sein wird.“
Erneut Schweigen.
„Hochwürden“, dem Geweihten stand das Unbehagen ins Gesicht, „Ich glaube, ich kenne ihren Vater...“
Líadáin holte hörbar Atem, drehte ihren Kopf zu ihm und blickte ihm direkt in die Augen: „Bruder, so lange Ihr nur glaubt ihren Vater zu kennen und Euch nicht sicher seid, was Ihr noch nicht einmal sein könntet, selbst wenn Ihr in Betracht kämt, werdet Ihr schweigen. Sie hatte gewiss gute Gründe, warum sie niemanden – nicht einmal mir – seinen Namen anvertraute. Von einer guten Reputation zeugt dies freilich nicht. So halte ich es für besser, wenn diese Person niemals in ihr Leben tritt. Sie wird ihr nur Schaden und noch mehr Dreck aufwühlen und davon gibt es bereits genug.“
Das Herz des Geweihten schlug schnell. Sein Mund wurde trocken.
„Marbolieb braucht keinen Vater, Bruder. Sie hat uns. Wir sind ihre Familie. Wir sind alles was sie braucht“, in ihrem Blick lag Hoffnung.
„Ihr habt recht, Schwester“, Hal nickte und rang sich ein Lächeln ab, „Räblein hat uns. Wir sind ihre Familie.“
(Zehnter Teil)
Passweiser, 1043
Am späten Nachmittag erreichte Marbolieb Tempeltreu schließlich Passweiser. Ihr Weg führte sie jedoch nicht in das Dorf hinein, sondern zu dem kleinen Boronanger außerhalb. Sie machte ein Runde darüber und richtete anschließend ein stilles Gebet an ihren Herrn.
Gerade als sie sich in Richtung Dorf wenden wollte, um sich eine Unterkunft für die Nacht zu suchen, fiel ihr Blick auf einem Mann an einem Grab. Das Grab war ihr zuvor bereits aufgefallen. Es sah aus, wie alle Gräber, bis auf seine Größe. Es war klein, geradezu winzig. Es musste das eines Kindes, besser gesagt eines Säuglings, sein.
Marbolieb zögerte einen Moment, dann nahm sie all ihren Mut zusammen und trat zu dem Fremden an das Grab. Weil es so winzig war, wurde es von einem ebenso winzigen Brononrad geschmückt, hatte dafür aber eine kleine, in den Boden eingelassene Steinplatte auf der zu lesen war:
Also ein... Verwandter?
„Der Rabe erhält, was des Rabens ist“, erhob die Novizin leise ihre Stimme um den Trauernden nicht zu erschrecken, „Auch wenn keiner je sagen können wird, warum er manche von uns früher erhält, als andere.“
Ernst nickte der Mann. Er trug ein Langschwert an seinem Gürtel, was ihn als Ritter auswies. „Er war so kränklich und schwach“, begann er voll Trauer zu berichten, „Am Abend zuvor schien er so kräftig und stark, so voller Leben, wir dachten, er hätte es geschafft und dann...“ Seine Stimme brach. „... am Morgen hatte Golgari ihn geholt.“
Mitfühlend nickte sie.
„Wird...“, er wandte seinen Blick auf die Novizin, „Wird der Schmerz denn nie aufhören?“
Langsam nickte sie: „Er wird nie aufhören, Hoher Herr. Nie. Er wird Euch bleiben, ein Leben lang. Doch er wird Euch weniger oft plagen.“
„Ja“, erwiderte er kehlig und blickte wieder auf das kleine Grab vor ihm, „Wie recht Ihr doch habt. So recht.“
Einen Moment schwiegen sie beide und starrten auf das Grab des Kindes.
„Sollen...“, hob nun Marbolieb da an, „Sollen wir vielleicht gemeinsam ein Gebet sprechen?“
„Ja“, der Ritter nickte, „Das wäre schön.“
Dann beteten sie gemeinsam, gedachten anschließend des toten Kindes noch einige Zeit schweigend an dessen Grab und verließen schließlich gemeinsam in aller Stille den Boronanger.
Außerhalb des Boronangers wartete bereits ein Mädchen mit zwei Pferden. Marbolieb hatte sie zuvor nicht gesehen. Hatte sie wirklich so viel Zeit in stiller Zwiesprache mit ihrem Herrn verbracht und dabei die Ankunft der beiden Reiter nicht einmal bemerkt?
„Meine Pagin“, stellte der Ritter vor, „Lynia von Libellensee.“
„Boron zum Gruße“, grüßte das schwarzhaarige Mädchen artig.
„Boron auch mit dir“, erwiderte die Novizin, „Ich bin Marbolieb Tempeltreu.“
„Miljan von Pul“, komplettierte der Ritter nun die Vorstellungsrunde, „Kommt Ihr vom... Etilia-Tempel, Schwester Marbolieb?“
Sie nickte.
„Und Ihr seid... zu Fuß unterwegs?“
Erneut nickte sie.
„Ihr werdet es heute nicht mehr zum Tempel zurück schaffen, der Fußweg ist zu weit. Falls Ihr noch keine Unterkunft habt, dann begleitet uns doch ins Hundseck.“
„Ähm“, machte Marbolieb da, „Gerne, Hoher Herr. Ich bin nur etwas... hm... verblüfft. Viele wollen lieber keine Diener des Schweigsamen unter ihrem Dach wissen. Nicht einmal eine Novizin, wie ich eine bin.“
„Ach“, seufzte der Ritter schwer, „Der Tod wohnt schon lange im Hundseck. Seit dem Tod unseres Sohnes ist er zu meinem stetigen Begleiter geworden. Ich würde mich freuen, wenn ich jemand an meiner Seite wüsste, der mit ihm auch umzugehen weiß.“
(Elfter Teil)
Hundseck, 1043
(...)
(Zwölfter Teil)
Burg Rabenwacht, 1043
Als sich die Tür zu der kleinen Kapelle auf Burg Rabenwacht öffnete, schreckte die Junkerin zusammen. Eira ni Rían stand mit dem Rücken zu den beiden gerade eintretenden Besuchern. Auch als Líadáin ni Rían zu sprechen begann, dreht sie sich nicht um: „Räblein, das ist meine Schwester Eira ni Rían, Junkerin zu Rabenwacht.“ Sie hielt einen Moment inne, deutet neben sich und stellte die Novizin vor: „Blutige Distel, dass ist Marbolieb Tempeltreu.“ Noch immer drehte sich die Junkerin nicht um.
„Boron mit Euch, Euer Wohlgeboren“, grüßte die Novizin leise und augenblicklich jagte ein kalter Schauer Eiras Rücken hinab. Sie schüttelte sich leicht.
„Lass uns bitte allein, weiße Nelke“, bat die Hausherrin.
Fragend blickte Marbolieb ihre Mentorin an, die zögernd nickte: „Ich werde vor der Tür auf dich warten, Räblein. Sei ohne Furcht. Dir wird in diesen Mauern niemand ein Leid zufügen. Du musst wissen, meine Schwester hat deine Mutter sehr geliebt. Aus der tiefe ihres Herzens...“
Da begannen stumme Tränen über die Wangen der Junkerin zu rinnen. Eilig wischte sie sie fort.
„... und hat damit auch nie aufgehört“, endete die Geweihte und ging hinaus.
Es wurde still. Unerträglich still. Marbolieb fröstelte.
„Die weiße Nelke behauptet, du seist ihre Tochter“, die Ritterin drehte sich um und kam ihr bedrohlich nahe, „Sie behauptet, du hättest ihre...“ Mit einem beherzten Griff zog Eira der jungen Novizin ihren feinen schwarzen Schleier aus dem Haar. Marbolieb war so entsetzt, dass sie keinen einzigen Ton herausbrachte. Die Junkerin zuckte bestürzt zurück. Ihre Pupillen weiteten sich. Sie wollte etwas sagen, brachte aber erst nichts rechtes zustande bis sie dann schlussendlich hervorwürgte: „... Augen. Du hast... ihre Augen!“ Ihr entglitt der Schleier, sie wandte sich ab. „Ich habe... habe es ihr nicht glauben... wollen. Nicht können. Doch...“ So langsam sickerte die Wahrheit, die sie nicht hatte hören wollen, in sie hinein: Das Mädchen war ihre Tochter. Ihr Fleisch. Ihr Blut. „... nun? Nun stehst du vor mir und blickst mich aus ihren Augen an.“ Sie schauderte. „Aus ihren Augen!“
Inzwischen hatte Marbolieb ihren Schleier wieder in ihr Haar gesteckt. „Dann...“, stammelte sie verunsichert, „Dann... dann habt Ihr mich nicht angestarrt, weil... weil... ?“
„Nein“, erwiderte die Junkerin, „Es sind nicht deine Narben. Es sind deine Augen. Du hast ihre Augen. Die Augen deiner Mutter.“ Sie seufzte schwer. „Und für einen winzigen Augenblick, da glaubte ich, sie sei es, die mich anblicke...“
Eira wandte sich zu einer kleinen Nische und setzte sich an einen steinernen Sag. Geradezu zärtlich strich sie über die massive Grabplatte und wisperte leise: „Die weiße Nelke hat sie zu mir zurück gebracht. Seit dem ruht sie hier. Bei mir.“
Marbolieb schluckte.
„Sie war alles für mich. Einfach alles. Als sie starb, da verlor nicht nur sie ihr Leben, sondern ich verlor auch meines“, die Ritterin suchte den Blick der Novizin, „Hätte ich von dir gewusst, dann...“ Ihre Stimme brach.
„Was dann?“, hauchte Marbolieb leise.
„Ich weiß nicht“, gestand die Junkerin da schulterzuckend ein, „Ich weiß es einfach nicht. Ich...“ Sie senkte demütig ihr Haupt. „Ich kann mir selbst jetzt nicht vorstellen, dass sie je mit einem Mann...“ Erneut brach ihre Stimme. „Aber es muss wohl so gewesen sein. Du bist der Beweis.“ Sie hob ihren Blick wieder und bat: „Setz dich zu mir.“
Marbolieb setzte sich zu ihr in die Nische. Dann schwiegen sie sich an. Eine ganze Zeit lang.
„Wie... wie... wie war sie?“, hob die Novizin mit leiser Stimme an, „Wie war meine Mutter?“
Eira lächelte versonnen und erwiderte: „Wunderbar. Sie war einfach... wunderbar. Und... und... und so wunderschön. So... so...“ Sie blickte zu Marbolieb. „... so wie du.“
„Ich“, stammelte die Angesprochene da, „Ich bin doch nicht... schön! Ich bin...“
Eira lachte: „Genau das hätte sie auch gesagt. Genau das. Sie war so, wie du bist. Vielmehr bist du, wie sie war. Ja, du bist wie sie...“ Sie schwelgte in Erinnerungen.
„Aber sie... sie hatte doch keine Narben?“
„Keine, die man sehen konnte“, erwiderte Eira sehr ernst, „Bei ihr war es die Seele. Sie trug Wunden, die einfach nicht heilten, ganz gleich was sie tat. Es war mir egal. Ich hab sie geliebt. Bedingungslos geliebt. Damit habe ich nie aufgehört. Auch heute gehört mein Herz allein ihr.“ Sie hielt einen Moment inne. „Es gab nie jemand anderen an meiner Seite. Ich wollte auch nie jemand anderen. Ich wollte immer nur sie. Von jenem Augenblick, da ich sie das erste mal sah, da wollte ich immer nur sie.“
Marbolieb hörte aufmerksam zu.
„Es fühlt sich an, als würde sie neben mir sitzen“, erklärte die Junkerin und strich bedächtig über die Grabplatte des steinernen Sarge, ehe sie wieder die Novizin anblickte. Ihre Gesichtszüge waren weich. Ihre Augen glitzerten. „Dabei sitzt du neben mir. Du, ihre Tochter. Zweifelsohne bist du das, ihre Tochter. Du siehst nicht nur aus wie sie, du bist wie sie. Als… als ob ihr ein- und dieselbe Person wärt.“ Sie lachte. „Ich weiß, dass es Unsinn ist. Aber... aber... es fühlt sich so an.“
„Gefühle sind immer das was sie sind, Euer Wohlgeboren: Gefühle. Sie kennen kein richtig und auch kein falsch.“
„Ich sehe auch meine Schwester hat ihre Spuren hinterlassen“, meinte Eira nickend, „Sie hat... sie hat mir erst vor kurzem von dir erzählt. All die Götterläufe habe ich nichts gewusst.“ Sie lachte. „Gar nichts. Nicht einmal erahnt. Dabei hast du die ganze Zeit bei ihr gelebt. Sie hat ihr schweigen erst vor kurzem gebrochen. Ich weiß nicht, warum sie es mir jetzt gesagt hat. Es ist auch nicht wichtig. Nicht mehr. Ich habe lange darüber nachgedacht, warum es alles so gekommen ist und nicht anders, doch ich habe keine Antwort gefunden. Warum hat sie dich nicht mir sondern der weißen Nelke anvertraut? Du hättest es bei mir gut gehabt. Ich hätte dich großgezogen, wie mein eigenes Kind. Du hättest mein Erbe antreten können. Doch vor allem wäre immer etwas von ihr bei mir geblieben.“ Tränen funkelten in ihren Augen. „Ich werde wohl nie erfahren, warum es so gekommen ist, wie es kam.“ Sie schluckte. „Bei all den Dingen, die ich nicht weiß und auch nie wissen werde, so weiß ich doch eines: Die weiße Nelke ist nicht nur die beste Boron-Geweihte weit und breit sondern sie ist auch die beste Ziehmutter, die du hättest haben können. Sie liebt dich wie ihr eigenes Kind, wie auch sie dich geliebt hätte. Besser hättest du es nicht treffen können.“
Marbolieb konnte nur nicken.
„Es ist bereits spät und ich bin müde“, schloss die Ritterin da sichtlich erschöpft, „Geh zu Bett, Marbolieb.“ Sie schloss die Novizin zärtlich in die Arme. „Wir haben so lange auf diesen Tag gewartet“, sie lachte kehlig, „Wir könnten auch noch einen weiteren warten. Schließlich ist morgen auch noch ein Tag.“ Dann hauchte sie ihr einen Kuss auf die Stirn. „Boron mit dir, mein Kind. Boron mit dir.“
Die letzte Spur (Dreizehnter Teil)
Burg Rabenwacht, 1043